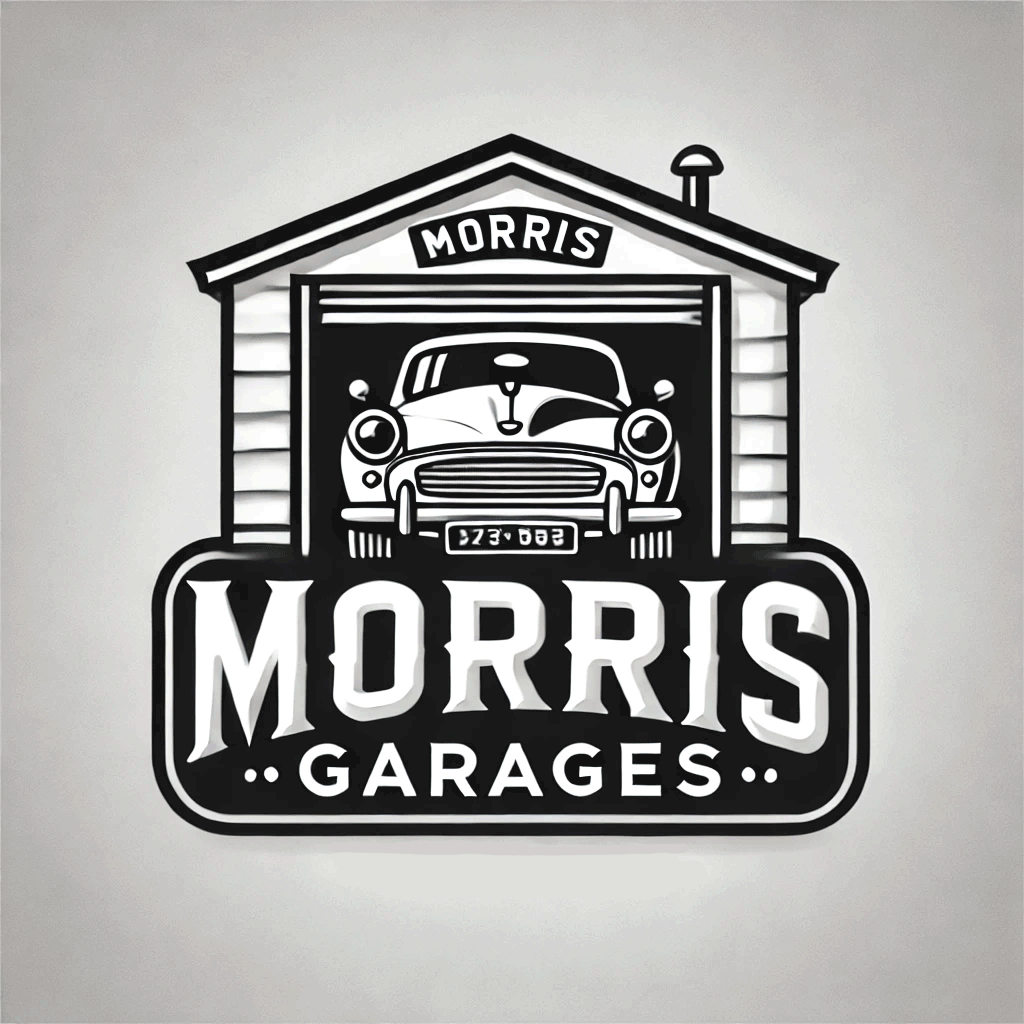Cooling / Wasserkühlung
Es gibt viele Diskussionen und Meinungen zu diesem Thema. Ich bin sicher, dass jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. In diesem Beitrag schreibe ich meine Erfahrungen auf, da wir uns auch lange mit diesem Thema beschäftigt haben und am Ende erfolgreich waren.
Ausgangspunkt:
- Der Wagen wird hauptsächlich in den Frühlings-Sommermonaten bewegt. Wir dürfen also von einer Temperatur von 10 bis 35 Grad Celsius Außentemperatur (im Schatten) ausgehen.
- Das KFZ soll Alpenpässe überqueren können – z.B. 2500 m.ü.M.
- Das Auto wird über 400km in einem Stück bewegt
- Als ich einen MGA übernahm, überhitze er im Sommer häufig, ich fürchtete schon im die Zylinderkopfdichtung
- Im Auto und in den Workshop-Manuals findet man häufig die Wärmeangabe in Grad Fahrenheit anstatt Grad Celsius
Die wichtigsten Wertangaben und Umrechnungen
| Grad Fahrenheit (gerundet) | Grad Celsius (gerundet) |
| 32 | 0 |
| 180 | 82 |
| 190 | 94 |
| 212 | 100 |
| 235 | 113 |
Da wir ein Auto übernommen haben, das im Sommer zu leichten Überhitzungen neigt, mussten wir der Sache auf den Grund gehen. Überhitzung ist ein Todesurteil für viele Autoteile. Vor allem Zylinderkopfdichtungen neigen dazu, bei großer Hitze ihren Geist aufzugeben. In verschiedenen Foren haben wir gelesen, dass ab 235 Grad Fahrenheit die Gefahr steigt, dass wir durch die Hitze einen weiteren Schaden auslösen. Nehmen wir also diese Temperatur als Maximum an. Kurzfristig können Bauteile >235 Grad Fahrenheit überleben, wie z.B. mgaguru.com schreibt. Sogar 250 Grad Fahrenheit sollen kurzfristig möglich sein. Dennoch sollte man sich Sorgen machen, wenn die Temperaturanzeige dauerhaft über 212 Grad Fahrenheit liegt.
Im ersten Schritt haben wir den Temperaturfühler und das Anzeigeinstrument des Fahrzeugs getestet. ich schraubte die Sonde ab und legte sie in einen heißen Kochtopf. Dazu kam ein digitales Thermometer. Bei 95 Grad stellten wir eine Abweichung von +3 bis +5 Grad Celsius fest. Aus meiner Sicht passt das, denn das visuelle Ablesen ist sicher auch fehleranfällig und das Instrument zeigt höhere Temperaturen an. Das Schätzeisen im Fahrzeug funktioniert also.
Die Vergaser lieferten kein zu mageres Gemisch (höhere Temperaturen) und die Zündung sowie die Ventileinstellung waren in Ordnung. Auch diese Punkte prüfte ich im Vorfeld.
Ich stellte leider fest, dass das System nicht druckstabil war. Sobald ein Druckanstieg (durch Wärmeausdehnung des Kühlmittels etc.) im Kühlsystem auftrat, begann es an zwei Stellen zu tropfen.
- Thermostatabdeckung (an den Stehbolzen – Richtung Mutter)
- Übergang Wasserpumpe zu Kühler
Somit musste ich erstmal die Lecks abdichten. Bei der Abdeckung (Thermostat) habe ich die Stehbolzen entfernt, die Gewinde mit LocTide 243 eingeschmiert und die Dichtung ersetzt. Beim Übergang mussten wir den Schlauch ersetzen, da er schon leicht ramponiert war und zogen alle Rohrschellen fest. Und wenn der Deckel schon mal runter war, haben wir auch gleich das Thermostat geprüft. Wir haben den Regler ins heisse Wasser gelegt und den Wassertopf ständig weiter erhitzt. Ferner steckten wir ein digital Wärmemessgerät dazu. Bei ca. 70-75 Grad Celsius begann sich das Ventil sichtbar langsam zu öffnen. Bei 85-90 Grad Celsius war es komplett offen. Nun nahmen wir es aus dem Wasser heraus und es schloss sich wieder (langsam). Man darf also annehmen, dass der Temperaturregler grundsätzlich funktioniert. Ich baute alles wieder zusammen erneuter die Dichtung (Kork). Davor reinigten ich natürlich alle Flächen. Wenn man die Mutter zu stark anzieht, dann quillt die Dichtung heraus. Also Achtung. Gefühlt reichen 20 Nm Anzugsmoment. Das LocTide dichtet das Gewinde gut ab und hält die Muttern dort, wo sie bleiben sollen.
Nun hielt das System den Druck. Dennoch kochte das Wasser immer wieder bei Bergfahrten.
Wir nahmen den nächsten Verdächtigen vor – der Kühler, wie es uns empfohlen wurde. Der Kühler wurde ausgebaut und geprüft. Wir füllten Wasser in den Einfüllstutzen und liessen es laufen. Dabei erhöhten wir die Wassermenge stetig, bis das Wasser aus dem „Eingang“ überquellet. Es war erschreckende, wie wenig Wasser am Ausgang herauskam und wie gering die Durchflussmenge ist. Auch wenn wir die technischen Daten dazu nicht exakt kannten, die Schlussfolgerung war, dass der Kühler wohl „zu“ war.
Der Durchfluss war deutlich zu gering, dazu muss man kein Fachmann sein, um das zu erkennen. Also auf zum Kühlerbauer (juhu – es gab noch einen in München in der Landsbergerstr.). Dieser teilte uns mit, dass man ein neues Netz einlöten müsste. Der Preis hierfür erschreckte uns (ab 450 Euro). Ich sah uns erstmal um. Was kostet ein neuer Kühler, gibt es gebrauchte Kühler sowie welche Alternativen habe ich sonst noch. Am Ende kam ich auf einen Alukühler. Die Wärmeabfuhr von Alu ist höher als die von einem Originalkühler (Messing usw.). Gegen Alu spricht: „Einmal gebrochen, kann man es nur sehr schwer wieder flicken“. Wir haben uns dennoch für eine Alukühler entschieden.
Neuen Kühler eingebaut und wir fuhren wieder in die Berge. Alles schon sehr gut, aber noch nicht perfekt. Bei längeren Steigungen wurde er immer noch übermäßig warm.
Der Motor wurde gespült mit Zitronensäure. Ich hatte Angst, dass sich die Core-Plugs ebenso lösen, wenn wir den Dreck aus dem Motor entfernen. Massive Verstopfungen konnten wir nicht erkennen. Auch nicht mit Hilfe der Endoskopie. Das konnte es also nicht gewesen sein. Grundsätzlich bin ich immer vorsichtig, wenn man säurehaltige Produkte in den Motor kippt. Ich war anfänglich skeptisch. Aber ein Fachmann meinte, dass es so gehört. Es gibt aber auch andere Meinungen. Ich kann hier nur sagen. Viel Dreck kam nicht heraus. Der Frostschutz hat davor wohl gute Arbeit geleitet. Die Core-Plugs sind noch fest.
Sollte ich vielleicht den Kopf abbauen und dort die Kanäle durchblasen? Ich bekam viele Tipps. Elektrisches Lüfter, war ein Vorschlag, der immerzu kam. Ich schaute mir die Eckdaten der Lüfter an. Max. 8,2 A Strombedarf. Im Dauerbetrieb bis zu 4A. Das macht satte 50 Watt aus. Das verkraftet die Lichtmaschine nur, wenn ich ohne Licht fahre u/o die Batterie stets voll ist. Somit stand fest. Nein, kein zusätzlicher Verbraucher.
Durch Zufall – bei einer Ausfahrt- teilte uns ein Mitfahrer mit, als er den Motor begutachtete, dass der Lüfterflügel falsch herum montiert ist. Es käme zu ungewollten Verwirbelnden und die Kühlleistung nehme deutlich ab. Technisch gesehen, war das nachvollziehbar, so wie es mir erklärt wurde. Auf den Lüfterflügel hatte ich bisher noch nie geachtet. In Fachbüchern und um Internet habe ich mich über das Thema weiter schlau gemacht. Ich kam zu dem Fazit, dass der korrekte Einbau durchaus eine wesentliche Rolle spielt. Somit bauten wir alles um. Leider hat das der Vorbesitzer nie entdeckt.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass eine Wasserpumpe nicht die Schuldige ist, wenn die Kühlleistung nicht passt. Ich muss aber sagen, dass die Konstruktion der MGA Wasserpumpe sicherlich nicht optimal ist. Die Konstruktion vom MGB gefällt mir deutlich besser. Wasserpumpen werden undicht und/oder die Lager gehen kaputt. Anderen Defekt kenne ich nicht.
Wir fuhren also erneut in die Berge (selbe Strecke – ähnliche Außentemperatur) und siehe da. Davor >=235 Grad Fahrenheit – bei gewissen Bergstrecken. Nach dem Flügelumbau 210 Grad Fahrenheit (gleiche Strecke). Bei normaler Fahrt nie über 190 Grad Fahrenheit. Bei dieser Temperatur ist die Verbrennung auch optimal. Dauerhaft niedrig Temperatur hat einen negativen Einfluss. Der Verbrennungsvorgang ist nicht optimal. Reste vom Benzin können erhalten bleiben und z.B. ins Öl gehen.
Fazit
Zusammenfassung:
- Kühlerausbau und Tausch war nötig, da er „zu“ war
- Lüfterflügel richtig herum eingebaut.
- Mischverhältnis 50/50 G48 o.ä. und dest. Wasser
- Verschlussknapp öffnet bei 7 PSI bzw. 0,5 Bar.
- Thermostat 82 Grad Celsius
- Motorspühlung – aber noch nicht notwendig
Nachtrag (Nov. 2023): BASF G48 gibt es nicht mehr im Handel (1 Liter Flaschen). Meine verwendete Alternative ist nun KFS 11 von Liqui Moly oder Mannol AG11.
Das KFS11 scheint sich gut mit dem vormals verwendeten G48 zu vertragen. Nach 500 Meilen konnten wir noch keine Nebeneffekte erkennen.